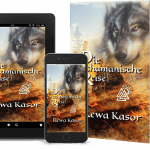25. Sigrdrifumal.
Die Einwirkung der Götterlieder auf die Heldensage, die wir schon bei den frühern Liedern bemerkt haben, tritt hier noch stärker hervor. Wie dem Hawamal das Loddfafnismal und Odhins Lied von den Runen angehängt sind, so wird hier Brynhilden (Sigrdrifen) ein jenem odhinischen ähnliches mythisches Runenlied und dann ein dem Loddfafnismal nachgebildetes ethisches Lied in den Mund gelegt. Wahrscheinlich waren sie vorhanden und allgemein bekannt ehe sie hier eingefügt wurden. In Brynhilds Munde passt der Sittenspruch Str. 22 wenig. Bei Aufnahme des Spruchgedichts in unser Lied hat man nicht bedacht, daß er Brynhildens Charakter widerspreche. Rechnen wir diese Nachklänge der Göttersage ab, so ist das, was dem gegenwärtigen Liede für die Heldensage übrig bleibt, von geringem Belang. Das Wichtigste ist noch was die Prosa erzählt, obgleich sie seltsamer Weise Sigurs Ritt durch Wafurlogi nur andeutet, nicht ausdrücklich (wie das vorige Lied Str. 42. 3) meldet. Auch D. 62 erwähnt desselben gerade hier nicht, wo er doch unbezweifelt hingehört, wohl aber später als Sigurd mit Gunnar um Brynhild wirbt. Da aber, könnt es scheinen, hab es des Zaubersfeuers nicht mehr bedurft, da der Zauber bereits gebrochen und dem Ausspruche Odhins (Brynhildens Todesfahrt 9. 10) genügt war. Die Beziehung des Zauberfeuers auf Odhins Spruch hat eine Verwirrung in unsere Lieder gebracht, die ich früher durch die Vergleichung der nordischen Sage mit der deutschen schlichten zu können glaubte. Allein ich sehe jetzt, daß das doppelte Reiten durch die Flamme, wie es die nordische Sage meldet, das Ursprüngliche sein muß, indem nur bei dieser Annahme der Zusammenhang der Heldensage mit der in Skirnisför enthaltenen Göttersage klar wird, wobei ich an das erinnere, was oben über die doppelte Gestalt dieses Liedes ausgeführt ist. In der ältern war es Freyr selbst, der durch Wafurlogi ritt, in der jüngern that es Skirnir für ihn. Beide Formen des Mythus sehen wir in der Heldensage verbunden, indem Sigurd das erstemal für sich selbst, das andremal für den Freund und Herrn durch die Flammen reitet. Vgl. Handb. §. 30. In der nordischen Gestalt der Heldensage ist also nur eins verwirrend, daß Odhin das Zauberfeuer um Brynhildens Burg geschlagen haben soll, denn es müste seinem Ausspruch gemäß nach dem ersten Ritt Sigurds erloschen sein. Gleichwohl war diese Annahme nothwendig, wenn die Göttersage in Heldensage umgestaltet werden sollte. Ursprünglich war Sigrdrifa Odhins Gemahlin, wie wir an dem Schutze sehen, den sie dem Agnar gegen Hialmgunnar gewährt haben soll. Vgl. Helreidh. 8. Auch Friggs Günstling war Agnar gewesen (Grimnismal Einleitung), sie hatte ihm das Reich durch eine List verschafft, die jener gleicht, durch welche sie dem Winilern gegen Odhins Willen den Sieg zuwandte. Nach Grimnismal ließ sich das Odhin gefallen; es muß aber eine Gestalt die Sage gegeben haben, in welcher der höchste der Götter sich als weniger gutmüthigen Gatten erwies. Diese Gestalt klingt in der Heldensage nach. Näher ist dieß Zeitschr. für Myth. II. 7 ff. ausgeführt.
Bei der Annahme, daß das Spruchgedicht Str. 22–36 früher vorhanden war ehe es hier eingefügt wurde, versteht es sich von selbst, daß dieß von Str. 37 nicht gelten kann, welche eine Anspielung auf Sigurds frühen Tod enthält, die wahrscheinlich bei jener Einverleibung hinzugedichtet wurde.
26. Bruchstück eines Brynhildenliedes.
Wir haben diesem Liede die Überschrift gegeben, welche es in der Urschrift führt, obgleich wir keineswegs überzeugt sind, daß es ein Bruchstück ist. Nach der von uns angenommenen Anordnung der Strophen und den Lesarten, von welchen wir bei der Übersetzung ausgegangen sind, die zum Theil allerdings auf Conjectur beruhen, scheint wenig oder nichts mehr zu fehlen. In der ersten Strophe liest der Text: „Wie bist du, Brynhild, Budlis Tochter;“ dann müste man aber entweder zwischen dieser und der folgenden Strophe, oder zwischen der zweiten und dritten, eine Lücke annehmen je nachdem man die zweite Strophe Brynhilden oder Gunnarn in den Mund legte. Ist aber die erste Strophe, wie es uns scheint, von Högni an Gunnar gerichtet, so ist alles in Ordnung, und diese Einleitung wenigstens nicht mehr lückenhaft. Zwischen der dritten und vierten mag allerdings noch etwas vermisst werden, da der Einwürfe Högnis ohnerachtet Gunnars in der ersten Strophe schon angekündigtes Vorhaben ausgeführt wird. Allein bei dem Plane des Liedes, welchen erst der Schluß deutlich macht, fehlt nichts Wesentliches. Es soll das tragische Geschick der Giukungen dargestellt werden, welche sich zu Sigurds Ermordung durch dessen Treubruch berechtigt und gegen Brynhild verpflichtet geglaubt hatten, jetzt aber, da sie seine Unschuld erkennen, vor ihrem eigenen Bewustsein selber als meineidige Mörder erscheinen. Wie es Brynhild war, die ihnen Sigurds Treulosigkeit vorgespiegelt hatte um sie zum Morde zu reizen, so ist es auch wieder Brynhild, die sie, da der Mord vollbracht ist, wie es Str. 14 heißt, wie ihr böses Gewissen meineidig schilt und Sigurds Treue auf das Nachdrücklichste schildert. In Bezug auf Brynhilden tritt also zwischen ihrem Benehmen vor Sigurds Ermordung und nach derselben der Widerspruch hervor, welchen die Schlußstrophe, die früher als 15te an der unrechten Stelle stand (obgleich das S. Bugge nicht zugestehen will, der doch sonst unserer Anordnung und Auslegung folgt), ausdrücklich bespricht. Aber erst die Nacht nach Sigurds Ermordung, wo Gunnars Gemüth von schreckhaften Bildern ergriffen wird, sollte den Wendepunkt bilden; darin liegt eine große Feinheit: vor dieser Nacht durfte Brynhild noch in dem alten Tone sprechen, damit am folgenden Morgen die Wahrheit desto greller hervorträte. Diesem Plane gemäß bringen die ersten Strophen nur kurz in Erinnerung, daß Gunnar von Brynhildens Vorspiegelungen verblendet die Ermordung Sigurds, den er für meineidig hielt, gegen Högnis Einspruch betrieben und wie wir aus der vierten Strophe ersehen, durchgesetzt hat. Die fünfte Strophe, die sonst die eilfte bildete, aber beßer hier ihren Platz findet, knüpft an die Thatsache des vollbrachten Mordes schon die Ahnung der Rache. Aber schlimmer als die künftige Rache durch Atli ist das Gericht des eigenen Gewißens, und daß dieß Gunnarn verdammen werde, spricht Gudrun in der eilften Strophe ahnungsvoll aus. Was der Rabe Str. 5 angekündigt hatte, kann erst später ganz in Erfüllung gehen, obwohl schon in diesem Liede Gunnar davon beunruhigt wird. Aber Gudruns Prophezeiung Str. 11, daß Gunnarn böse Geister ergreifen würden, erfüllt sich sogleich hier, zunächst schon in den beiden folgenden Strophen, wo die Reue ihn zu ängstigen beginnt; noch weit mehr aber wird sie, wie uns der Dichter zu ermeßen überläßt, über ihn Gewalt haben, wenn er das Grauenvolle seiner That erkannt hat, die er jetzt noch, der letzten Worte des Raben ungeachtet, für berechtigt halten muß. Ihn darüber zu enttäuschen, ihm die Worte des Raben in ihrer ganzen unheilschweren Bedeutung auszulegen, dienen Brynhildens Worte in den Str. 15 bis 18, die ihn erkennen laßen, daß er gegen Sigurd treulos und um so schlechter gehandelt hat als dieser ihm unverbrüchliche Treue zu bewahren mit rührender Sorgfalt beflißen war. So schließt sich Str. 19 vortrefflich an, die Brynhilds ganzes Benehmen gegen die Giukunge zusammenfaßend eine beßere Stelle nicht finden konnte. Erst muste doch Brynhilds Rede zu Ende sein ehe von deren Wirkung auf die Giukungen berichtet werden konnte.
Nach dieser Ausführung und bei solcher Anordnung der Strophen halten wir dieses s. g. Bruchstück nicht nur für ein Ganzes, sondern für eins der besten und ergreifendsten unseres nordischen Heldenbuchs.
Die Schlußbemerkung, die vielleicht von dem Sammler herrührt, macht auf die abweichenden Berichte über den Ort, wo Sigurd erschlagen ward, aufmerksam. Mit dem Berichte der deutschen Männer, welchem das gegenwärtige Lied folgt, stimmt von den nordischen noch das zweite Gudrunenlied, hier mit Recht als altes Lied von Gudrun bezeichnet, weil es älter ist als das erste, während das folgende Lied, das dritte von Sigurd, Hamdismal und die damit zusammenhängende Aufreizung Gudruns ihn im Bette neben Gudrun erschlagen laßen. Welche Angabe die richtige ist, läßt sich hieraus nicht entscheiden, da sowohl ältere als jüngere Lieder verschiedenen Berichten folgen. Darin werden wir aber dem Sammler beistimmen müßen, daß Sigurds Ermordung im Walde deutscher Sage gemäß ist, und diese mag hier das Ursprüngliche bewahrt haben.
Die Lücke, welche sich zwischen diesem und dem vorhergehenden Liede in der Sage bemerklich macht, und durch die folgenden Lieder von Brynhild und Gudrun nur zum Theil ausgefüllt wird, läßt den Verlust einer beträchtlichen Anzahl alter Lieder beklagen, indem Sigurds Verlobung mit Gudrun, Werbung um Brynhild für Gunnar, der Zank der Königinnen und Sigurds Tod übergangen sind. Bruchstücke dahin gehöriger Lieder hat die Wölsungasage erhalten und wir glauben sie hier einrücken zu müßen. Die beiden ersten finden sich Cap. 36 und zeigen, da sie sich auf die Werbung Gunnars um Brynhild beziehen, deutlich die oben besprochene Verwirrung in der nordischen Heldensage, welche noch einen zweiten Ritt durch das von Odhin um Brynhilds Burg geschlagene Feuer annehmen muste, das mit ihrer Erweckung durch Sigurd erloschen scheinen könnte.
Das Feuer brauste, die Erde bebte,
Die hohe Lohe wallte zum Himmel.
Wenige wagten da das Heldenwerk,
Ins Feuer zu sprengen, noch drüber zu steigen.
Sigurd schlug mit dem Schwert den Grani,
Das Feuer erlosch vor dem fürstlichen Helden.
Die Lohe legte sich vor dem Lobgierigen;
Die Rüstung blinkte, die Regin beseßen.
Die dritte, welche das 38te Cap. bewahrt hat, folgt auf den Zank der Königinnen und die Entdeckung des Betrugs:
Von dem Gespräche ging da Sigurd
Des Königs Freund von Kummer gebeugt.
Vor Schmerzen sprang dem Schlachtbegierigen
Der Halsberg entzwei und die Harnischringe.
Glücklicherweise sind die hier ausgefallenen Theile der Sage in den Nibelungen sehr gut und nach eigentümlicher Überlieferung ausgeführt.